
Bist du eigentlich eine gute oder schlechte Schulleitung?
Du gibst dir immer Mühe und trotzdem: Du bekommst Kritik von Eltern, der Geschäftsführung oder deinen Kolleg:innen – autsch. Wie oft nimmst du dir so
Das Institut Wunder. Fliegen. Weiter. ist deine Anlaufstelle, wenn deine freie, reformpädagogische oder Montessori-Schulen sich endlich auf sichere und stabile Füße stellen soll.
Mithilfe der 7 Räume der Führung wirst du als Führungsperson deiner Schule gelassen und souverän in der Rolle.
Stöbere dich in diesem Blog durch viele spannende und wertvolle Impulse für deinen (Führungs-)Alltag!

Du gibst dir immer Mühe und trotzdem: Du bekommst Kritik von Eltern, der Geschäftsführung oder deinen Kolleg:innen – autsch. Wie oft nimmst du dir so
In der Führung kommt es sehr stark darauf an, deine Energie auf die richtigen und wichtigen Dinge zu richten. Wie bei der Grünen Meeresschildkröte, deren Verhalten ganz tief in ihrem Wesen verankert ist, setze ich mit meiner Arbeit bei der Führungshaltung an. Ein Anker (Raum der Standfestigkeit) wird gesetzt, ein Feuerdrache (Raum der Leidenschaft) wird aktiviert, ein innerer Kompass (Raum der Selbstkontrolle) wird ausgerichtet.
Führung wird leicht und freudvoll, verbindend und klar.
Was ist Journaling? Beim Journaling geht es darum, die eigene Entwicklung durch das Schreiben zu begleiten, oder man könnte auch sagen, sich schreibend zu entwickeln.

Dich selbst und andere zu ermächtigen ist eine wertvolle Aufgabe für die Schulleitung
Das V steht für Volatilität, das U steht für Ungewissheit, das K steht für Komplexität und das A steht für Ambiguität.
Ich war in einer großen Schule in Niedersachsen. Schulinterne Lehrerfortbildung für über 100 Pädagog*innen. Mein Workshop, den ich für knapp 20 Lehrer*innen hielt, hieß „Beziehungsorientierte
Mein Start als Schulleiterin war nicht einfach, in diesem Artikel erzähle ich über meine anfänglichen Schwierigkeiten.
12 Affirmationen für mehr Klarheit in der Schulleitung. Probiere es aus! Es funktioniert.
Ein Wendepunkt hat immer zwei Seiten. Eine Seite beendet etwas, schließt einen Lebensabschnitt ab und die andere Seite beginnt etwas, läutet einen neuen Lebensabschnitt ein.
Ziele sind grundlegend wichtig für den Erfolg als Führungspersönlichkeit.
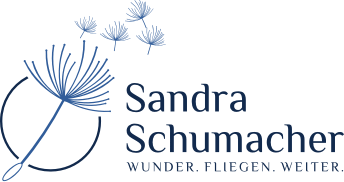
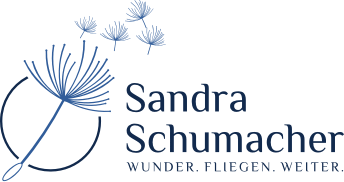
Die Online-Ausbildung zur souveränen Führungsperson an Schulen nach den „7 Räumen der Führung“
Alle Workshops in den kommenden Monaten
Austausch mit anderen Schulleitungen – immer wenn du es brauchst
Alltagshelfer zum Sofort-Download oder Bestellen
Individuelle Unterstützung von Sandra Schumacher
Langfristige und nachhatige Begleitung bei Struktur- und Veränderungs-prozessen
Dein Energie-Boost zum Wochenstart
Die Online-Ausbildung zur souveränen Führungsperson an Schulen nach den „7 Räumen der Führung“
Alle geplanten Workshops in den kommenden Monaten
Austausch mit anderen Schulleitungen – immer wenn du es brauchst
Kleine Helfer & Reminder zum Sofort-Download oder Bestellen
Individuelle Unterstützung von Sandra Schumacher
Langfristige und nachhatige Begleitung bei Struktur- und Veränderungs-prozessen
Dein Energie-Boost zum Wochenstart
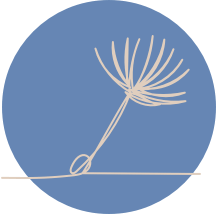

kontakt@sandra-schumacher.de

@sandra_schumacher_wunder

+49 179 3797215
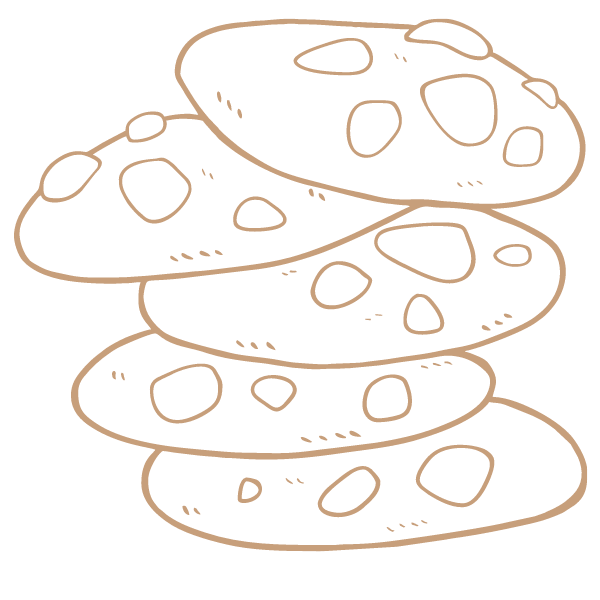
Wir wollen, dass du dich bei uns wohl fühlst. Deswegen nutzen wir Cookies, auch von Dritten. Sie helfen uns, dass die Seite sicher läuft und wir deine Erfahrung stetig verbessern können.
Einige der Kekse sind notwendig: Ohne sie läuft hier gar nichts und deswegen sind sie voreingestellt.
Andere Kekse kannst du ablehnen – leider können wir dir dann nicht die beste Erfahrung ermöglichen.
Mehr Infos findest du in unserer Datenschutzerklärung.